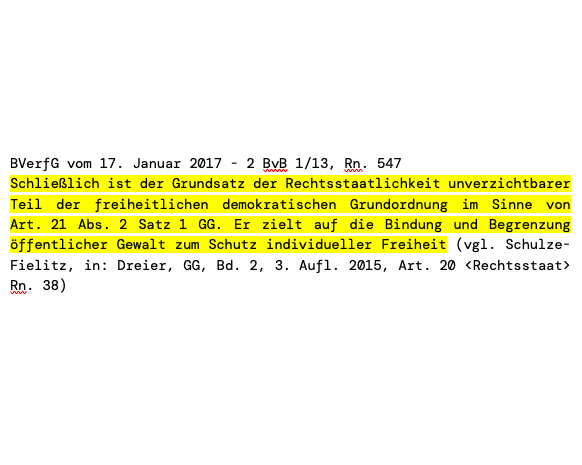
Zur Situation der Rechtstaatlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland
Mit unserer Stellungnahme beziehen wir uns auf den Report des Wirtschafts- und Sozialausschusses zur Evaluation und Implementierung von Maßnahmen von 2024 und beschreiben unsere Kenntnisse und Analysen zur Situation der Rechtsstaatlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland. Die VDJ wurde im Jahr 1972 als Berufsorganisation für die verschiedenen juristischen Berufe gegründet. Ihre Absicht ist es, repressiven Tendenzen in Staat und Gesellschaft entgegenzuwirken. Die Verteidigung von rechtsstaatlichen Verfahren ist ein satzungsmäßiges Ziel unserer Vereinigung. Zu diesem Zweck gibt sie jedes Jahr mit neun weiteren Bürgerrechtsorganisationen den Grundrechte-Report „zur Lage der Bürger- und Menschenrechte“ heraus. Er dokumentiert auch die Entwicklung des Rechtsstaats.
Mit diesem Bericht, der sich auf die Zeit von 2021 bis heute bezieht, wollen wir die Arbeit des Ausschusses unterstützen und zu einem vielschichtigen Bild der gegenwärtigen Situation der Rechtsstaatlichkeit in der Bundesrepublik sowie den neueren Entwicklungen beitragen.
Institutionen des Rechtsstaats
Krisen der Rechtsstaatlichkeit werden oft anhand vorsätzlicher Rechtsbrüche oder Angriffen auf die Unabhängigkeit der Justiz durch die Exekutive festgemacht. Vor diesem Hintergrund erscheint die rechtsstaatliche Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland auf dem Papier als resilient. Wir möchten jedoch die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie auch in einem Staat wie der Bundesrepublik schrittweise Entwicklungen vonstatten gehen, die rechtsstaatliche Errungenschaften und Standards aushöhlen können.
Die Ausbildung stabiler und wirkmächtiger Institutionen, die sicherstellen, dass rechtliche Verfahren eingerichtet, ausgeübt und kontrolliert werden, ist eine zentrale Voraussetzung von Rechtsstaatlichkeit. In der Entstehung moderner Rechtsstaaten bilden sich staatliche, privatwirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Institutionen heraus, die eine moderne Form von Rechtsstaatlichkeit entstehen lassen und gegen Erosionseffekte absichern. Der moderne Rechtsstaat zeichnet sich durch das Prinzip der Gesetzlichkeit der Verwaltung, den Vorrang der Verfassung, die darin verkörperten Bürger- und Menschenrechte, insbesondere die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, eine wirksame Kontrolle durch unabhängige Gerichte sowie durch freie Medien aus. Im Zusammenwirken bilden staatliche und private Institutionen eine Kultur der Rechtsstaatlichkeit heraus, in der es zwar zu punktuellen Rechtsverletzungen kommt, die Rechtsordnung und rechtliche Verfahren aber grundsätzlich und selbstverständlich Beachtung finden.
Neben den staatlichen Behörden mit einer Verwaltungshierarchie, Mechanismen der Selbstkontrolle und unabhängigen Gerichten darf die Bedeutung der privaten Institutionen, wie eine freie und staatsferne Presse, selbständige Interessenvertretungen und Vereine (Anwaltskammern, Industrie- und Handelskammern, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände oder Nichtregierungsorganisationen), für die Lebendigkeit und Wirksamkeit von Rechtsstaatlichkeit aus unserer Sicht nicht unterschätzt werden. Sie erzeugen Aufmerksamkeit für Probleme und Rechtsverstöße, bringen ihre Auffassung und Interessenlage bei der Durchsetzung des Rechts in den juristischen Prozess ein und wirken an einer professionellen und kompetenten Rechtsfindung mit. Sie sind ein wesentlicher Pfeiler der rechtsstaatlichen Kontrolle.
Was wir in unserem Report hervorheben, ist einerseits, dass die zivilgesellschaftlichen Institutionen, die zur Sicherung des Rechtsstaats beitragen, Angriffen durch die Hoheitsträger ausgesetzt sind. Andererseits wird die Kultur der Rechtsstaatlichkeit, wie wir die Selbstbindung der hoheitlichen Institutionen nennen wollen, durch die Exekutive zuletzt offen in Frage gestellt. Diese beiden Entwicklungen gefährden den erreichten Stand der Rechtsstaatlichkeit in der Bundesrepublik. Diese Tendenzen gilt es aus unserer Sicht so früh wie möglich zu beschreiben und zurückzuweisen, um eine Verfestigung zu verhindern.
Die Zivilgesellschaft steht unter Druck
Zivilgesellschaftliche Institutionen können in der Bundesrepublik offen und in vielen Bereichen ohne Repressionsgefahr agieren. In Bereichen, in denen sich die Zivilgesellschaft gegen wichtige Regierungsziele oder gegen extrem rechte Akteure positioniert, gilt dies jedoch nur eingeschränkt. Die Entziehung der Steuerprivilegierung „Gemeinnützigkeit“ für antifaschistische Vereine (wie die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, kurz: VVN-BdA) oder Organisationen, die sich für eine andere Steuerpolitik und für Umverteilung einsetzen (wie attac), war in der Vergangenheit Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Die „Gemeinnützigkeit“ ist für Organisationen lebenswichtig, da sie eine staatsfreie Finanzierung über Spenden ermöglicht. Zudem kam es in den vergangenen Jahren durch Regierungsvertreter und Landesrechnungshöfe zu Vorwürfen gegenüber zivilgesellschaftlichen Trägern und Organisationen, die öffentliche Förderung erhalten, dass sie nicht "neutral" seien. Dabei bezogen sich diese Vorwürfe auf Akteur*innen, die Position gegen extrem rechte Parteien oder auch die menschenrechtswidrige Abschiebepolitik der Regierung bezogen haben. Die Politisierung der Gemeinnützigkeit und die instrumentalisierte Bezugnahme auf eine „Neutralität“ der Zivilgesellschaft erhöht die Abhängigkeit von politischen Entscheidungsträgern und ist ein Mittel, mit dem die Regierung Einfluss auf die Zivilgesellschaft nehmen kann.
Zwei hervorgehobene Anlässe für eine verstärkte Repressionsgefahr haben wir beobachtet: Waren es nach 2021 Klimaproteste, die sich übermäßiger staatlicher Repression ausgesetzt sahen (siehe dazu den Bericht Green Legal Spaces 2025 von der NGO Green Legal Impact), ist es zuletzt stärker das Thema „Krieg und Frieden“, das eine Repressionsgefahr mit sich bringt.
Dabei wollen wir zugleich einen Unterschied betonen: Im Zuge der Klimaproteste wurden die Ziele der Bewegung zumindest in Teilen von Regierung und Verwaltung als unterstützenswert ausgegeben. Die Repression richtete sich überwiegend gegen eine als besonders radikal wahrgenommene Form des Protests: Blockaden, ziviler Ungehorsam, „Klimakleben“. Diesen Formen des Protests begegnete die Exekutive vielfach mit unverhältnismäßigen und teilweise mit rechtsstaatswidrigen Maßnahmen. Es erfolgten Hausbesuche bei Aktivist*innen, es kam zum Einsatz von Schmerzgriffen und anderen Formen der willentlichen Schmerzzuführung und im Bundesstaat Bayern wurde die sog. Präventivhaft eingesetzt. Präventivhaft ist eine aus unserer Sicht rechtsstaatswidrige Form der Strafe, bei der Personen bis zu 30 Tage inhaftiert werden können, um eine von den Behörden nur vermutete, zukünftige Straftat zu verhindern. Diese Haftform ist mit dem Rechtsprinzip nulla poena sine culpa unvereinbar. Die Maßnahme hat repressiven Charakter, wird aber bisher von den Gerichten unzutreffenderweise als präventiv angesehen (BayVerfGH 14.06.2023 - Vf. 15-VII-18).
Das spezifisch Neue der letzten Jahre liegt in der gezielten Verfolgung von bestimmten Meinungsinhalten. Anlass für die Repression ist dabei regelmäßig nicht die radikale Form, in der die Meinung vorgetragen wird, sondern der Inhalt der Kritik wird zum Anknüpfungspunkt für staatliche Eingriffe.
Als das antimilitaristische Bündnis „Rheinmetall entwaffnen“ für Ende August 2025 zu einer Protestwoche mit Camp mobilisierte, verbot die Stadt Köln die Abschlusskundgebung. Nachdem die Gerichte die Rechtswidrigkeit des Verbots festgestellt hatten, konnte die Demonstration zwar stattfinden, die Teilnehmenden wurde aber ohne ausreichende Gründe über vier Stunden in einen sog. Polizeikessel gesperrt, die Presse berichtete von gewaltsamen Übergriffen durch die Polizei. Es liegt nahe, dass die Verwaltung trotz entgegenstehender gerichtlicher Entscheidung die effektive Durchführung eines Demozugs nicht akzeptieren wollte, der sich unzweideutig gegen Aufrüstung, gegen die Einführung der Wehrpflicht und gegen die Unterstützung des Kriegs in Gaza richtete.
Im Mai 2025 kritisierte der Menschenrechtskommissar des Europarates, Michael O'Flaherty, in einem Brandbrief an Bundesinnenminister Dobrindt die staatliche Gewalt gegenüber Demonstrierenden, insbesondere im Bezug auf Demonstrationen zum Thema „Gaza“ (https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/meinungsfreiheit-und-polizeigewalt). Diverse teilweise weit zirkulierte Videoaufnahmen von Polizeigewalt anlässlicher dieser Versammlungen belegen die Verbreitung des Problems. Das unterstützt die Vermutung, dass die Repressionsgefahr vom Inhalt der Meinungsäußerung abhängt, was rechtsstaatlichen Prinzipien widerspricht.
Einen besonders eklatanten Fall des inhaltlich motivierten Verbots der Freiheitsausübung stellt das Verbot von sog. Zivilklauseln im Freistaat Bayern dar. Das Bundesland verbietet es Universitäten, ihre Forschung auf friedliche und zivile Ziele zu begrenzten und eröffnet die Möglichkeit, Forschende zur Kooperation mit der Bundeswehr zu verpflichten. Das greift in die Freiheit der Wissenschaft und die Autonomie der Hochschulen ein.
Als demokratische Jurist:innen stehen wir nicht per se an der Seite aller zitierten Proteste machen uns ihre Inhalte nicht prinzipiell zu eigen. Jedoch bemerken wir eine hoheitliche Einschränkung des Freiheitsgebrauchs infolge inhaltlicher Ablehnung von Meinungsbeiträgen, die wir insgesamt kritisch beobachten. Ein Ausgreifen der staatlichen Repression auf den zivilgesellschaftlichen Meinungsaustausch droht in eine Aushöhlung der Kommunikationsgrundrechte umzuschlagen.
Normative Verbindlichkeit für die Exekutive
Im Ganzen sehen wir die Gefahr, dass die normativen Selbstbindungskräfte der hoheitlichen Gewalten abnehmen. Diese Gefahr wollen wir an ausgewählten Beispielen plausibel machen.
In der Nacht zum 28.06.2024 wurde die deutsche Staatsbürger*in Maja T. nach Ungarn überstellt. Sie steht in Verdacht, in Ungarn an Straftaten beteiligt gewesen zu sein. Zwar hatte ein Berliner Gericht die Überstellung für rechtmäßig erklärt. In einer ungewöhnlichen Nacht-und-Nebel-Aktion war die Beschuldigte dann aber in der Nacht nach der Entscheidung nach Bayern verbracht und dort morgens an die Österreichische Polizei für eine Durchlieferung nach Ungarn übergeben worden. Dies alles geschah vor dem Hintergrund einer Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die für den Morgen des 28.06.2024 zu erwarten war. Erwartungsgemäß entschied das Verfassungsgericht, dass eine Überstellung wegen der zu erwartenden menschenrechtswidrigen Haftbedingungen in Ungarn verfassungswidrig sei. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Behörden aber bereits Tatsachen geschaffen. In seiner Hauptsacheentscheidung kritisiert das Bundesverfassungsgericht nicht nur die beteiligten Behörden ungewöhnlich scharf, sondern auch das Kammergericht, weil es sich mit losen Zusagen der ungarischen Behörden zufrieden gegeben habe, statt den menschenrechtlichen Schutz sicherzustellen (BVerfG vom 24. Januar 2025 - 2 BvR 1103/24). Die außergewöhnliche Überstellung hatte eine Vorgeschichte: Die Behörden hatten den Verdächtigen in diesem Tatkomplex immer wieder angedroht, eine Überstellung nach Ungarn durchzuführen, wenn sich die Verdächtigen nicht kooperativ verhalten würden. Die Rechtsverweigerung und offenkundige Umgehung einer verfassungsgerichtlichen Prüfung steht damit in dem Verdacht, vorsätzlich und planmäßig erfolgt zu sein. Die Exekutive hat sich ganz bewusst der Gesetzesbindung enthoben, um das von ihr verfolgte Ziel zu erreichen. Dieses Verhalten hat sie vorher angedeutet, um damit den Willen der Beteiligten zu brechen. Diese Drohung konnten die Behörden aber nur unter Missachtung des Rechtsschutzes durchsetzen.
Ein weiteres Beispiel betrifft die Palästina-Solidarität. Im April 2024 sollte in Berlin ein sog. Palästina-Kongress stattfinden, bei dem internationale Gäste zur Situation in Gaza und im Westjordanland sprechen sollten. Der Kongress wurde zum Gegenstand einer medialen Kampagne, die auf die Verhinderung dieses durch Artikel 8 des Grundgesetzes geschützten Zusammenkommens zielte. Der Berliner Regierende Bürgermeister kündigte bereits vor Beginn des Kongresses an, dass dieser Kongress nicht stattfinden werde. Am Versammlungsort fanden sich Dutzende Polizisten ein, die die Versammlung sofort unter einem Vorwand auflösten. Damit setzten sie die rechtsstaatswidrige Weisung des Regierenden Bürgermeisters durch, eine zulässige Versammlung wegen ihres unerwünschten Inhalts zu verhindern. Im Zuge des Kongresses waren zudem Betätigungs- und Einreiseverbote verhängt worden, deren Rechtswidrigkeit mittlerweile zumindest teilweise festgestellt wurde (so für das Betätigungsverbot VG Berlin 15.07.2025 - 24 K 493.24; Ralf Michaels, Welche Regeln gelten in Berlin?, Berlin Review vom 02.05.2024: https://blnreview.de/ausgaben/2024-05/ralf-michaels-palaestina-kongress-rechtsstaat-repression).
Im Juni 2024 gab die damalige Bildungsministerin Stark-Watzinger in ihrem Ministerium die Prüfung in Auftrag, ob es möglich sei, Wissenschaftler*innen, die einen offenen Brief zur Räumung eines Protestcamps in Berlin unterzeichnet hatten, die Wissenschaftsförderung zu entziehen. Damit brachte sie zum Ausdruck, dass die Regierung die staatlichen Finanzen als Mittel ansieht, die nach politischer Gefälligkeit vergeben werden können. Immerhin gab es innerhalb des Ministeriums erhebliche Einwände seitens der Ministerialbeamt*innen, die diese Prüfung verhinderten (https://fragdenstaat.de/artikel/exklusiv/2024/06/bmbf-pruefbitte-fu-berlin-offener-brief/).
Ein weiteres eklatantes Beispiel für die Selbstentbindung von einer rechtlichen Verpflichtung ist die Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz vom Februar 2025, dass der seit November 2024 mit einem vom Internationalen Strafgerichtshof per Haftbefehl gesuchte israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bei einem Besuch in Deutschland nicht festgenommen würde, obwohl das nach unzweifelhafter Rechtslage die völkerrechtliche Pflicht der Bundesrepublik wäre (https://verfassungsblog.de/rechtsbruch-netanjahu-merz-festnahme-haftbefehl-rechtswidrig/). Damit stellt der Regierungschef der Bundesrepublik die verfassungsmäßig festgeschriebene Gewaltenteilung in Frage und erweckt den Eindruck, die Regierung könne sich durch Willenserklärung von ihren verfassungsmäßigen und internationalen Pflichten entbinden.
Im negativen Sinne exemplarisch ist auch der Umgang mit den Grenzschließungen an den Binnengrenzen innerhalb des Schengenraums, die von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) am 7. Mai 2025 gegenüber der Bundespolizei angewiesen wurden. Gegenüber dem prinzipiell zulässigen Argument, die Grenzschließungen reagierten auf einen vorübergehenden „Notstand“, bestanden von Anfang an so offenkundige rechtliche Bedenken, dass kaum anzunehmen war, dass die Regierung diese Maßnahme im Glauben an die Rechtmäßigkeit durchführte (https://verfassungsblog.de/zuruckweisung-grenze-kontrolle-dobrindt/). Nachdem das Verwaltungsgericht Berlin die Zurückweisungen in drei Eilentscheidungen als europarechtswidrig beurteilte (VG Berlin 02.06.2025 - 6 L 191/25 u.a.), erklärte Dobrindt, dass es sich um Einzelfallentscheidungen handle und hieraus keine Pflicht zur Änderung der Praxis an den Grenzen folge. Dabei ging es grundsätzlich um die vorrangige Anwendbarkeit des Europarechts und das VG Berlin rügte ebenfalls die nicht vorhandene Begründung für die Aktivierung einer europarechtlichen Notlage oder Ausnahmeklausel nach Art. 72 AEUV. Deshalb handelte es sich hierbei nicht um Einzelfallentscheidungen. Darauf machte sogar der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts aufmerksam (https://www.spiegel.de/politik/migrationspolitik-praesident-des-bundesverwaltungsgerichts-kritisiert-alexander-dobrindt-a-881eab7a-b72d-46b5-9ac8-38df462eae0d). Nachdem Innenminister Dobrindt zunächst in Aussicht stellte, mit einer umfassenden Begründung im Hauptsacheverfahren die Rechtmäßigkeit der Handlung belegen zu wollen, gab die Regierung später ihren Widerstand gegen die Erledigung des Hauptsacheverfahren auf.
Fazit
Rechtsstaatlichkeit beruht immer auf den Selbstbindungskräften des Rechts innerhalb der Exekutive. Die Bereitschaft, sich an Recht und Gesetz zu halten, geht zurück. Das artikulieren die Hoheitsträger immer unverblümter. Das ist gefährlich, weil die Erosion der Rechtsstaatlichkeit ein Prozess ist, der sich nicht beliebig einfangen lässt, wenn das Vertrauen in die Rechtstreue von Regierung und Verwaltung brüchig wird.
Die Angriffe auf die Zivilgesellschaft durch die Exekutive stehen auch vor dem Hintergrund, dass diese Institutionen der freien Verfügung der Exekutive über das Recht entgegenwirken, die Gesellschaft kritisch informieren und bei Verstößen mobilisieren können, was für einen funktionierenden Rechtsstaat lebenswichtig ist. Gleichzeitig sieht die Regierung in dieser Zivilgesellschaft immer mehr ein Hindernis für ein möglichst störungsfreies Regieren.
Wegen der vielfältigen Einbindung in ein institutionalisiertes Netz der Rechtsstaatlichkeit (neben der Zivilgesellschaft auch auf Ebene der Europäischen Union und des Europarats) ist die Wirkung der beschriebenen Missachtung des Rechtsstaats nicht, dass in der Bundesrepublik von einem Tag auf den anderen der Zustand der Rechtlosigkeit eintritt. Wie beschrieben gibt es die Möglichkeit nachträglicher gerichtlicher Kontrolle, die regelmäßig zum juristischen Erfolg führt. Aber auch die Einhaltung gerichtlicher Entscheidungen ist dann nicht mehr selbstverständlich. Deshalb beobachten wir mit größter Sorge, wenn sich die Exekutive nicht mehr „von selbst“ an das Recht halten will. Die gerichtliche Kontrolle kommt zudem notwendigerweise vielfach zu spät, es sind die „vollendeten Tatsachen“, vor denen die Betroffenen dann erst einmal rechtlos stehen – die dargestellten Beispiele zeigen das. Ein lebendiger Rechtsstaat setzt voraus, dass alle staatlichen Gewalten die Unbedingtheit normativer Pflichten selbständig akzeptieren.
Staaten wie Ungarn oder Polen, in denen diese Prozesse früher eingesetzt haben und die nicht über ein vergleichbar dichtes Netz an zivilgesellschaftlichen Kräften zur Bewahrung der Rechtsstaatlichkeit verfügt haben, zeigen, wohin sich die beschriebenen Tendenzen entwickeln können, wenn ihnen nicht ebenso starke Kräfte entgegenwirken. Für eine Stärkung des Rechtsstaats benötigt es:
- Die Bewahrung und Stärkung einer selbständigen Zivilgesellschaft
- Die Sicherung einer auch von Regierung und Verwaltung unabhängigen Justiz
- Die Freiheit von Presse, Versammlung und Wissenschaft auch für regierungs- und staatskritische Positionen.
Der Bundesvorstand der Vereinigung Demokratischer Jurist:innen e.V. (VDJ)